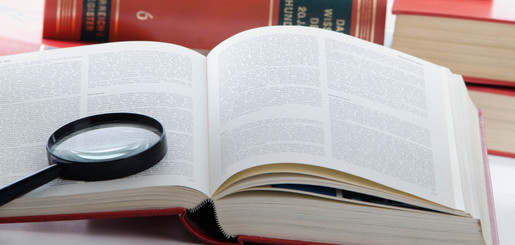dbb BildungsgewerkschaftenBildungsministerkonferenz: Digitalisierung im Fokus
In dem erstmals ausschließlich als Bildungsministerkonferenz tagenden Gremium (Bildungs-MK) wurden am 10. Oktober 2024 Empfehlungen für den Umgang mit KI besprochen.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Gerhard Brand sagt: „Schule kann sich der Entwicklung von Digitalität nicht entziehen. Umso wichtiger ist es, dass hierfür Rahmen gesetzt und Leitlinien bestimmt werden. Wichtig bleibt das Bekenntnis zum Primat der Pädagogik. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, ihr Einsatz muss einen erkennbaren Nutzen für die Schülerinnen und Schüler haben.“ Zudem lobt er die umfassende Betrachtung von Chancengerechtigkeit beim Umgang mit KI.
In der Empfehlung würden die Chancen durch den Einsatz von KI sehr ausführlich behandelt, zu kurz kämen jedoch die Herausforderungen, so Brand weiter: „Dass es ein Potenzial für individuelle Förderung gibt und die Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden können, wird hinreichend dargestellt. Während die konkrete Formulierung von Aufgaben unterschiedlicher Kompetenzniveaus unterstützt werden kann, müssen durch die Lehrkraft aber viel individuellere Lernwege nachvollzogen und begleitet werden. Wenn noch dazu ein ‚breit aufgestellter Katalog zeitgemäßer Prüfungsformate‘ angewendet werden soll, ist das zwar sinnvoll, um unterschiedliche Lernniveaus, Voraussetzungen und Kompetenzen zu adressieren. Es ist aber mitnichten eine Entlastung für Lehrkräfte, sondern bedarf eines noch individuelleren Blicks auf Lernwege, -fortschritte und -ergebnisse. Die Entlastung durch KI ist ein Versprechen ohne Gewähr!“
Bereits im Vorfeld der Bildungs-MK und angesichts fortschreitender Überlegungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen, warnte der Deutsche Philologenverband (DPhV) vor übertriebenen Erwartungen und plädiert für einen kritisch-konstruktiven Umgang mit KI. Die DPhV-Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing sagte: „Das Wichtigste in schulischen Erziehungs- und Bildungsprozessen ist die menschliche Interaktion zwischen Lehrkräften und ihren Schülern und zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander. Bei aller Euphorie um die spannenden Möglichkeiten, die KI heute schon bietet und in Zukunft bieten wird – wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass dadurch über Nacht die Probleme des Lehrkräftemangels gelöst werden. Im Gegenteil: Wer davon träumt, dank KI zeitnah weniger professionelle Lehrkräfte als bisher einsetzen oder sie gar durch KI ersetzen zu können, ist auf dem Holzweg!“ Lin-Klitzing wies weiter darauf hin, dass auch durch den Einsatz von KI Lehren und Lernen nicht beliebig effektiviert werden könne: „Lernen und Verstehen von Inhalten braucht Zeit, einfach weil die Schülerinnen und Schüler die Inhalte für sich selbst noch einmal durchdringen und durchdenken müssen – das kann ihnen keine KI abnehmen. Erst recht nicht, weil die kritische Prüfung der durch KI präsentierten Inhalte zunehmend bedeutsam und schwierig werden wird.“
Notwendig sei es, dass die Bildungs-MK und die Kultusminister und -ministerinnen in ihrem Land solide Rahmenbedingungen als Voraussetzung für die Nutzung von KI schaffen. Lin-Klitzing: „Da gibt es noch etliche Fragezeichen, schon allein was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht. Denn beim Einsatz von KI müssen sowohl die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler als auch die der Lehrkräfte gewahrt werden – mit einem an höchsten Sicherheitsstandards orientierten Identitätsmanagement. Zudem muss die Frage erlaubt sein, wie die ohnehin schon stark beanspruchten Lehrkräfte neben etlichen anderen hoch priorisierten Themen, wie z.B. Demokratiebildung, nun auch noch KI gewinnbringend in ihren Unterricht einbinden können. Hier brauchen Lehrkräfte mehr Fortbildungsressourcen, und sie brauchen ebenso eine Senkung des Unterrichtsdeputats. Für die Nutzung, hier beispielsweise für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler, braucht es neben der Zeit auch didaktische Konzepte und verlässliche technische Rahmenbedingungen.“
Der VDR Bundesvorsitzende Ralf Neugschwender sagte im Vorfeld zur weiterhin ausstehenden Einigung zwischen Bund und Ländern zum „Digitalpakt 2.0“: „Es ist beschämend, dass der Digitalpakt 2.0 immer noch nicht in trockenen Tüchern ist. Dieses eklatante Versagen der Bildungspolitik in Deutschland raubt unseren Schulen Planungssicherheit und unseren Schülerinnen und Schülern Zukunftschancen. Wir brauchen dringend eine langfristig ausgerichtete Verstetigung der finanziellen Mittel. Dank des ersten Digitalpakts konnten bereits viele Klassenzimmer zu digitalen Unterrichtsräumen werden. Umso wichtiger ist, dass es im Jahr 2025 nahtlos weitergeht. Deutschland darf in Europa nicht noch weiter abgehängt werden, sondern muss gerade jetzt am Ball bleiben. Es geht nicht nur um Chancengerechtigkeit, sondern auch um die beruflichen Perspektiven unserer Jugendlichen. In einer Zeit, in der die Digitalisierung sehr schnell fortschreitet, müssen alle unsere Schülerinnen und Schüler auf eine digital vernetzte Welt vorbereitet werden. Vor dem Hintergrund, dass sich in sozialen Medien wahre und unwahre Informationen in rasender Geschwindigkeit verbreiten, gilt es, den Jugendlichen schulische Bedingungen zu bieten, die eine sinnvolle Nutzung digitaler Instrumente und eine kritische Auseinandersetzung damit auch ermöglichen. Der Digitalpakt 2.0 muss daherkommen, ohne Wenn und Aber. Bund und Länder sind in der Pflicht, auf der Bildungsministerkonferenz, die einen Austausch mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zum Digitalpakt 2.0 vorsieht, endlich handfeste Ergebnisse zu präsentieren.“