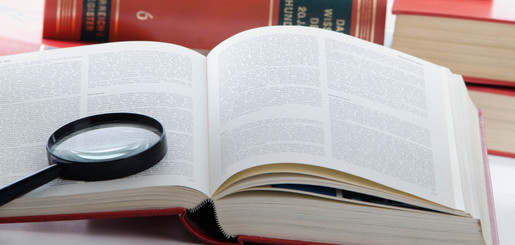Seniorenpolitische FachtagungAlle Lebensalter müssen gleich behandelt werden
Politik und Gesellschaft sollen Ageismus systematisch abbauen, fordert Horst Günther Klitzing von der dbb bundesseniorenvertretung auf der Seniorenpolitischen Fachtagung.
„Die Frage, wie vorhandene rechtliche Vorgaben uneingeschränkt auch für Ältere erfüllt und gleichermaßen deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden kann, ist angesichts der demographischen Entwicklung in unserem Land gesellschaftspolitisch hoch relevant“, sagte Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, zur Eröffnung der 9. Seniorenpolitischen Fachtagung, zu der sich am 14. Oktober 2025 mehrere hundert Personen aus Seniorenorganisationen des dbb und weiterer Verbände, aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft in Berlin versammelt hatten.
Im Mittelpunkt der Tagung unter dem Titel „Generation Ü65 – unterschätzt und übersehen?“ stand der Ageismus, also stereotype Vorstellungen, Vorurteile und Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters. Im Kampf gegen das weit verbreitete, doch oft unerkannte und nur selten hinterfragte gesellschaftliche Phänomen formulierte Klitzing fünf Forderungen: „Das Lebensalter soll ausdrücklich in das Gleichbehandlungsgebot in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen werden. Bei jedem Gesetzesvorhaben müssen Folgen für ältere Menschen geprüft werden, sonst verfestigt sich ungewollte Ungleichbehandlung“, so der Chef der dbb-Senioren. Gegen pauschale Altershöchstgrenzen - etwa für Kredite – solle die Politik klare Vorgaben machen, damit die Wirtschaft flexibler auf die Bedürfnisse Älterer eingeht und sich die Teilhabe-Möglichkeiten für Seniorinnen und Senioren verbessern. Zudem forderte Klitzing, Bund und Länder sollten in breiten, zeitlich unbegrenzten Kampagnen unterschiedliche Altersbilder sichtbar machen, um ageistische Stereotype in der Gesellschaft aufzubrechen und zu überwinden. Außerdem solle die Bildungssituation der älteren Generation jährlich im Nationalen Bildungsbericht abgebildet werden – als Datengrundlage für eine Nationale Bildungsstrategie.
„Recht, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit sollen Ageismus systematisch abbauen – durch rechtliche Absicherung, überprüfte Altersgrenzen, dauerhafte Aufklärung und eine bessere Datenlage zur Bildung im Alter“, fasste Horst Günther Klitzing seine Forderungen zusammen.
Perspektive Älterer stets berücksichtigen
„Unsere Gesellschaft altert – das ist Fakt“, betonte der dbb Bundesvorsitzende Volker Geyer in seinem Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Anteil der Menschen ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich von 12 Millionen im Jahr 1991 auf 19,0 Millionen im Jahr 2024 oder von 15 auf 23 Prozent. „Damit verändern sich gesellschaftliche Aufgaben und Herausforderungen an die sozialen Sicherungssysteme insbesondere in den Bereichen Alterssicherung, Gesundheit und Pflege“, so Geyer.
„Ich habe den Eindruck, dass Ältere zum Sündenbock der aktuellen Rentenpolitik und zu Verantwortlichen für leere Pflegekassen gemacht werden“, sagte der dbb-Chef. „Ich wünsche mir, dass in Politik, Gesellschaft und Medien ein Bild der älteren Generation gezeichnet wird, das ihr entspricht. Die, die heute im Ruhestand sind, haben in Jahrzehnten der Arbeit, der Verantwortung, der Stabilität in Familiennetzwerken, in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst unser Land getragen. Ist das alles vergessen? Insbesondere von denen, die ein soziales Jahr für Ruheständlerinnen und Ruheständler fordern?“
Zugleich betonte Geyer: „Ich unterstütze daher die Forderung der dbb bundesseniorenvertretung nach Erweiterung des Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz um das Diskriminierungsmerkmal ‚Lebensalter‘“. Bei Gesetzesvorhaben müsse frühzeitig die Perspektive älterer Menschen einbezogen werden. Etwa muss Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, auch am digitalen, gewährleistet werden, ebenso wie transparente, verlässliche Pflegestrukturen, faire Finanz- und Sozialleistungen, präventive Gesundheitsangebote, ausreichende Gesundheitsversorgung in der Stadt und auf dem Land.
Energiereserve für unser Land
Michael Brand, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betonte in seinem Grußwort, dass der Umgang mit Älteren entscheidend für die gesamte Gesellschaft sei. Es gehe darum, nicht nur deren bisher erbrachte Leistungen zu respektieren, sondern deren Potenziale für die Zukunft. „Die Älteren sind die Energiereserve für unser Land“, so Brand.
Aus dieser Überzeugung heraus sei auch der Neuzuschnitt des Ministeriums entstanden erklärte der Staatssekretär mit Blick auf die Entscheidung der neuen Bundesregierung, die Zuständigkeit für Jugend, Senioren und Bildung zusammenzulegen: „Frühkindliche Bildung hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Und das lebenslange Lernen ist ein zentrales Thema für alle.“
Deutlich wurde Brand auch mit Blick auf die aktuelle Rentendiskussion: Die Probleme der Alterssicherungssysteme ließen sich durch ein „alle zahlen ein“ nicht lösen, hier sei ein realistischer Blick auf die Herausforderungen nötig.
„Eine Gesellschaft des längeren Lebens“ als Chance
Prof. Dr. Eva-Marie Kessler, Prorektorin und Professorin für Gerontopsychologie an der MSB Medical School Berlin, unterstrich in ihrem Referat mit dem Titel „Ageismus – eine häufiges, wenig erkanntes und oft unwidersprochenes Phänomen“ zunächst, wie viel gesünder, zufriedener und produktiver ältere Menschen heute im Vergleich zu den Vorgänger-Generationen seien. „75 ist das neue 60“, brachte sie das Phänomen auf den Punkt. Dennoch verhindere latent vorhandener, weit verbreiteter Ageismus, „dass wir unsere Potentiale entfalten können.“ Anders als andere Diskriminierungsformen wie etwa Rassismus, betreffe der irgendwann alle, wenn sie alt genug würden. Sie nannte zahlreiche Beispiele für Altersstereotypen: im Vorgehen von Behörden und Organisationen, am Arbeitsplatz, in den Medien oder im Gesundheitswesen. Auch hinter einer weitverbreiteten Haltung des Mitleids mit Alten, im Absprechen von Kompetenz und in der Erwartung, die Älteren sollten nicht zur Last fallen, zeigt sich Ageismus. Alter werde als defizitär und weniger wert wahrgenommen. Noch in oberflächlich nett gemeinten Haltungen wie der Infantilisierung und Verniedlichung Älterer oder auch im Anbieten ungewollter Hilfe verberge sich Ageismus. Letztere würden von Betroffenen als besonders problematisch empfunden. Kessler betont, dass die schwerwiegendsten Folgen des Ageismus durch Altersstereotype verursacht würden, mit denen viele auf sich selbst blickten; mangelnde Wertschätzung der eigenen Person mache passiver, unzufriedener, kränker und schränke die kognitive Leistungsfähigkeit ein.
„Wir leben immer noch in einer alterssegregierten Gesellschaft“, analysierte Kessler und erinnerte an die nur geringen Kontakte zwischen arbeitenden und lernenden Generationen mit Menschen im Ruhestand, deren Alltag von viel Freizeit geprägt sei. Stattdessen solle der demografische Wandel als Gestaltungschance hin zu einer „Gesellschaft des längeren Lebens“ angesehen werden. Als Ziel nannte Kessler eine „altersintegrierte Gesellschaft“, in der einerseits die Politik ältere Menschen nicht mehr nur als Fürsorgeobjekte betrachtet. Andererseits sei es Sache der Älteren selbst die eigenen Glaubenssätze, wie etwa den des nicht zur Last fallen Wollens, zu hinterfragen und die vorhandenen Kompetenzen zu nutzen.
„Das Alter gehört ins Grundgesetz“
Dr. Stephan Gerbig, Richter am Arbeitsgericht Nürnberg und Lehrbeauftragter für Verfassungsrecht und Menschenrechte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat in seinem Vortrag eine pointierte Spurensuche unternommen: Warum schützt das Grundgesetz zwar vor Diskriminierung wegen Geschlecht, Herkunft oder Behinderung, nicht aber ausdrücklich wegen des Alters? Seine Antwort fiel deutlich aus: „Beim Schutz vor Altersdiskriminierung gibt es im Grundgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz noch viel Luft nach oben. Man muss sich nur trauen.“ Zwar listet Artikel 3 des Grundgesetzes Merkmale auf, die vor Benachteiligung schützen. Das Alter fehlt jedoch. Altersdiskriminierung kann bislang nur über den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gerügt werden. Für Gerbig ist das ein strukturelles Defizit, denn: Das Alter sei, wie Geschlecht oder Herkunft, ein unveränderliches Merkmal, das deshalb denselben Schutz verdiene. Zwar arbeite das Grundgesetz an einzelnen Stellen wie beim Wahlrecht oder bei der Amtszeit von Verfassungsrichtern selbst mit Altersgrenzen. Diese Normen seien jedoch verfassungsrechtlich abgesichert und stünden einer Ergänzung von Art. 3 Abs. 3 GG nicht im Wege.
Während das deutsche Grundgesetz das Alter also nicht nennt, tut es die EU-Grundrechtecharta ausdrücklich. Auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt im Arbeitsleben und im Zivilrecht vor Altersdiskriminierung, wenn auch mit zahlreichen Ausnahmen, etwa für Versicherungen oder bestimmte Beschäftigungsverhältnisse. „Man fragt sich, warum diese Ausnahmen eine seltsame Regelungstechnik aufweisen, die dazu führen kann zu glauben, der Gesetzgeber habe ein Handbuch geschrieben ‚Wie diskriminiert man richtig?‘“ Bemerkenswert sei weiter, „dass der Staat in der Privatwirtschaft Schutzpflichten gegen Altersdiskriminierung vorsieht, sich aber im eigenen Handeln diesem Maßstab nicht unterwirft.“
Gerbig plädierte für die Aufnahme des Alters in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale des Grundgesetzes. Eine solche Änderung hätte weitreichende Konsequenzen: Alle Altersgrenzen im einfachen Recht – von Berufsverboten bis zu Rentenregelungen – müssten künftig auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Altersgrenzen wären nicht automatisch verfassungswidrig, müssten aber „zwingend begründet“ sein. Damit würde, so Gerbig, eine gesellschaftliche Debatte über den Sinn und Unsinn von Altersgrenzen jenseits von Symbolpolitik angestoßen.
Interessant sei darüber hinaus, dass die Forderung nach einem Schutz vor Altersdiskriminierung sowohl ein seniorenpolitisches als auch ein kinderpolitisches Anliegen ist. Kinder und ältere Menschen würden gleichermaßen mit Stereotypen konfrontiert: Die einen, weil sie „noch nicht“, die anderen, weil sie „nicht mehr“ leistungsfähig seien. Schon das Deutsche Institut für Menschenrechte hatte 2016 gefordert, das Alter als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz aufzunehmen. Gerbigs Apell: Wenn das Grundgesetz die Werteordnung der Gesellschaft abbilden soll, dann muss es auch den Schutz vor Altersdiskriminierung ausdrücklich verankern. Nur so könne die Gleichheit der Generationen juristisch wie gesellschaftlich glaubwürdig umgesetzt werden.
„Rechte haben kein Ablaufdatum“
Negative Altersbilder prägen die Gesellschaft tief und bedrohen die Menschenrechte Älterer. Darauf wies Dr. Claudia Mahler, unabhängige Expertin der Vereinten Nationen für die Rechte Älterer und Teamleiterin am Deutschen Institut für Menschenrechte, in ihrem Impuls hin. Ihr zentrales Anliegen: Altersdiskriminierung nicht nur als gesellschaftliches, sondern als menschenrechtliches Problem betrachten. Von Kindheit an verinnerlichen Menschen stereotype Vorstellungen über das Alter, so Mahler. Diese Bilder seien oft negativ und spiegelten die Vielfalt des Alters kaum wider. „Solche Vorurteile führen zu Ageism – also zu systematischer Altersdiskriminierung“, betonte die Expertin. Das Thema sei in der Politik bislang kaum angekommen, obwohl die Auswirkungen weit reichen: Ältere Menschen erfahren Benachteiligungen etwa beim Zugang zu Arbeit, beim lebenslangen Lernen oder in medizinischen Notlagen, was sich besonders während der Corona Pandemie gezeigt habe.
Mahler erinnerte daran, dass Menschenrechte „kein Ablaufdatum“ haben. Dennoch würden mit zunehmendem Alter bestehende Ungleichheiten oft noch verstärkt und gesellschaftlich kaum hinterfragt. Negative Altersbilder erleichterten es, Diskriminierungen zu rechtfertigen. Betroffen seien zentrale Rechte: das Recht auf Leben und Gesundheit, auf Privatleben, Wohnen, Selbstbestimmung und auf den Schutz vor Katastrophen. Auch die digitale Teilhabe sei eine menschenrechtliche Frage. Die Expertin rief zu einem neuen Verständnis des Lebenslaufs auf: Lernen, Arbeiten und Ruhestand sollten nicht als starre Lebensphasen verstanden werden. Ein solidarischer Dialog der Generationen könne helfen, Vorurteile abzubauen, denn Ageism wirke „in beide Richtungen“, gegen Jung und Alt gleichermaßen.
International setzt sich Mahler für eine Stärkung des rechtlichen Rahmens ein. Die bestehenden Menschenrechtsabkommen stammen aus den 1960er-Jahren und decken die spezifischen Herausforderungen älterer Menschen nur unzureichend ab. Nach 14 Jahren Diskussion in der UN-Generalversammlung hat nun der Menschenrechtsrat in Genf eine intergouvernementale Arbeitsgruppe mit dem klaren Auftrag eingesetzt, ein rechtlich bindendes Instrument zum Schutz der Rechte Älterer zu entwickeln.
Wlodarek: Gewinne des Alters nicht aus den Augen verlieren
Seh- und Hörleistung lassen nach, die gesellschaftliche Rolle ist eine andere als früher, für den einen oder anderen ist auch Einsamkeit ein Thema: Menschen, die altern, denken häufig zuerst an die Schattenseiten. „Das alles darf man nicht kleinreden, es ist Teil der Realität“, sagte Dr. Eva Wlodarek, die einen Youtube-Kanal mit 270.000 Abonnentinnen und Abonnenten betreibt. „Aber man darf auch nicht die Gewinne des Alters aus den Augen verlieren, die es zweifelsohne ebenfalls gibt!“ Über die informierte die Diplom-Psychologin in ihrem Vortrag „Die sieben Gewinne des Alters – eine Ermutigung, die besonderen Möglichkeiten des Alters wahrzunehmen, zu schätzen und zu entwickeln“.
Aus dem Auf- und Ab des Lebens ergibt sich – erstens – Lebenserfahrung, und das bereits ab dem Kindesalter. Aber erst im Alter sei man in der Lage, Essenzen abzuleiten, sagte Wlodarek.
Ein zweiter Gewinn des Alters ist die Klarheit über die eigenen Bedürfnisse, so die Psychologin. Entscheidend sei, diese auch zu kommunizieren, sie einzufordern und gegebenenfalls auch einmal „Nein“ zu sagen. Loslassen können – dies sei der dritte Gewinn. Dabei gebe es zwei verschiedene Ebenen: „Manches muss man nehmen, wie es ist. Da rate ich allen zu radikaler Akzeptanz!“ Andere Dinge ließen sich beeinflussen: „Träume sollte man nicht zu früh loslassen! Es gibt 77-Jährige, die noch einen Surf-Rekord aufgestellt, und 85-Jährige, die erfolgreich einen Iron Man absolviert haben.“
Der vierte Gewinn sei Stilsicherheit, frei nach Coco Chanel: „Schönheit vergeht, Stil besteht“ – im Alter habe man das äußere Erscheinungsbild gefunden, das der eigenen Persönlichkeit entspricht, berichtete Wlodarek. Der fünfte Gewinn sei mehr Unabhängigkeit von der Meinung und Anerkennung anderer: „Im Alter kann man Dinge eher als Information hinnehmen und nicht als etwas, wonach man sich zwingend richten muss.“ Und damit gehe (sechstens) einher, dass es im Alter okay ist, sich auch Ruhe zu erlauben. Mach es allen Recht! Sei Perfekt! Mach schneller! – diese Denkweisen spielten nur noch eine untergeordnete Rolle.
Sich der eigenen Endlichkeit bewusst sein – das ist schließlich der siebte Gewinn des Alters, sagte die Psychologin. Es gebe viele junge Menschen, die viel zu früh wegen einer Krankheit oder eines Unfalls sterben. Die meisten seien sich ihrer Endlichkeit kaum bewusst gewesen. Ältere Menschen hingegen könnten absehen, wie viel Zeit ihnen noch bleibt, der Zeithorizont verändere sich. „Wer nur noch begrenzt Zeit hat, muss zusehen, dass er noch alles macht, was er machen will“, unterstrich die Psychologin. „Und dieses Bewusstsein ist ein großer Gewinn!“
Am Ende der Veranstaltung erinnerte Norbert Lütke, Zweiter Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, in seiner Dankesrede daran, dass die Rechte älterer Menschen unverhandelbar sind. Er versprach, dass sich die dbb Bundessenioren konsequent dafür einsetzen werde, Älteren echte Perspektiven zu verschaffen. „Wer sich nicht bewegt, kann Politikern nicht auf die Füße treten.“